Versorgungs-Report: Leitlinien - Evidenz für die Praxis
Medizinische Leitlinien: mehr Evidenz in der Gesundheitsversorgung
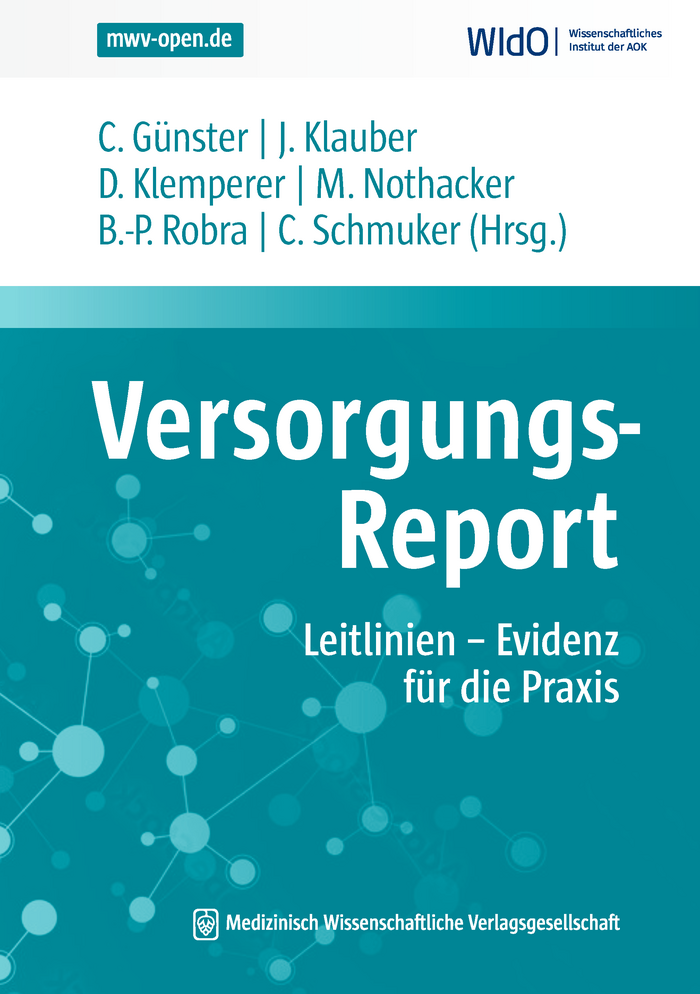
Diese Ausgabe des Versorgungs-Reports widmet sich schwerpunktmäßig der Bedeutung von medizinischen Leitlinien in der Gesundheitsversorgung. Leitlinien geben den Behandelnden diagnostische und therapeutische Empfehlungen an die Hand. Sie werden nach systematischen und evidenzbasierten Kriterien entwickelt und zielen darauf ab, die Versorgungsqualität für Patientinnen und Patienten zu verbessern. Als Patientenleitlinien nehmen sie Einfluss auf die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Ihre Umsetzung im Versorgungsalltag ist herausfordernd.
Die Expertenbeiträge im Versorgungs-Report setzen sich umfassend mit der Praxis von Leitlinien auseinander. Sie beschreiben Methodik und Verfahren zur Erstellung vertrauenswürdiger Leitlinien sowie zu ihrer Evaluation. Sie berichten über die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Umsetzung von Leitlinienempfehlungen in der realen Versorgung und stellen praxisorientiert Versorgungsstrukturen und konkrete Vertragsmodelle zur Förderung der Leitlinienanwendung vor.
Der Teil „Daten und Analysen“ berichtet auf Basis von AOK-Abrechnungsdaten über die Häufigkeit von Erkrankungen und Behandlungen in Deutschland und nimmt dabei die Auswirkungen der Pandemie in den Blick. Weitere Daten zu Behandlungshäufigkeiten von mehr als 1.500 Krankheiten stehen unter www.mwv-open.de zur Verfügung.
Teil I Grundlagen
Zielsetzung medizinischer Leitlinien
Bernt-Peter Robra, Monika Nothacker und David KlempererMedizinische Leitlinien sind Entscheidungshilfen für die Diagnose und Behandlung definierter gesundheitlicher Probleme in der Versorgungpraxis. Sie stellen den Stand des Wissens dar, wenn sie auf Grundlage von systematischer Evidenzrecherche, -bewertung und -synthese und als konsentierte Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Ihr Empfehlungscharakter lasst Raum für Besonderheiten jedes medizinischen Einzelfalles, für das fachliche Urteil der professionellen Versorgenden (Arztinnen und Arzte sowie Angehörige weiterer Gesundheitsberufe) und für Werteurteile und Präferenzen der betroffenen Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen. Da Leitlinien auch Patienten adressieren, werden ihre Vertretenden regelhaft in die Leitlinienentwicklung einbezogen.
Auf Ebene des Gesundheitssystems sind Leitlinienempfehlungen komplexe Interventionen in die Versorgung mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Leitlinien entstehen in Deutschland in professioneller Autonomie der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Das Regelwerk der AWMF bindet die Fachgesellschaften an explizite Verfahrensregeln und damit ihre Definitionsmacht an die beste verfügbare Evidenz. Dies fordert Transparenz, Akzeptanz und Umsetzung der Leitlinienempfehlungen. In ihrer Umsetzung beeinflussen Leitlinien Prozesse, Ergebnisse, Ressourcen und Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Ihre Effekte bedürfen der Evaluation, dies ist ein Auftrag für die Versorgungsforschung.
Der vorliegende Beitrag orientiert über die Ziele medizinischer Leitlinien und führt in den Versorgungs-Report 2023 mit dem Schwerpunktthema „Leitlinien – Evidenz für die Praxis“ ein.
Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien - deutsch und internationale methodische Standards und Entwicklungen
Monika Nothacker, Jörg Meckel und David KlempererDas vorrangige Ziel von Leitlinien ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung. Leitlinien sollen – systematisch entwickelt – den gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergeben, um die Entscheidungsfindung für eine angemessene gesundheitliche Versorgung zu unterstutzen. In Deutschland sind die wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften für die Erstellung von Leitlinien zuständig, die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) koordiniert die Leitlinienarbeit durch das Vorhalten eines qualitätsgesicherten Leitlinienregisters mit einer methodischen Stufenklassifikation von S1-S3 und des AWMF-Regelwerks mit Regeln und Hilfen für die Erstellung hochwertiger Leitlinien. Die aktuelle Leitlinienmethodik basiert auf international anerkannten methodischen Standards, u.a. der AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation) collaboration, des Guidelines International Network (GIN) und der GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) Arbeitsgruppe. Zu den Standards gehören eine repräsentative Leitliniengruppe mit Patienten- bzw. Burger-Beteiligung, das Interessenkonfliktmanagement, die Festlegung von relevanten Fragestellungen und Endpunkten, die systematische Evidenzrecherche und kritische Bewertung der Evidenz, die Formulierung handlungsleitender, graduierter Empfehlungen mit nachvollziehbarer, kriteriengestützter Begründung, die strukturierte Konsensfindung und die Publikation in verschiedenen Formaten inkl. laienverständlicher Versionen und Entscheidungshilfen. Die Ableitung und Umsetzung leitlinienbasierter Qualitätsindikatoren ist wünschenswert. Das AWMF-Leitlinienregister enthalt ca. 850 Leitlinien von mehr als 100 federführenden Fachgesellschaften. Seit mehr als einem Jahrzehnt zeigt sich eine Entwicklung zu methodisch höherwertigen Leitlinien. Wissenschaftlich weiterentwickelt werden derzeit v.a. rasch aktualisierte „Living Guidelines“ und digitale Leitlinienformate, die eine Einpassung in ein digitales „Evidenz-Ökosystem“ mit direkter Anbindung an die Nutzenden ermöglichen. Aktuelle, methodisch hochwertige Leitlinien sind ressourcenintensiv. Dies ist eine Herausforderung für Leitliniengruppen.
Interessenkonflikte und Leitlinien
David Klemperer und Klaus LiebInteressenkonflikte gehen mit Biasrisiken einher, die zu verzerrten Bewertungen entscheidungsrelevanter Informationen und damit zu fehlerhaften fachlichen Entscheidungen fuhren können. Die Entwicklung von Leitlinienempfehlungen erfordert daher eine Methodik, die das Biasrisiko von Interessenkonflikten minimiert. Ein wichtiger Verursacher von Interessenkonflikten ist die pharmazeutische Industrie mit ihrer doppelten Zielsetzung Gewinnorientierung und Patientenwohl. Ihre Kooperation mit Arztinnen und Ärzten und ihren Organisationen ist regelhaft Teil der pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Dabei setzt oder verstärkt sie dem Patientenwohl nachrangige, sekundäre Interessen aufseiten der Arztinnen und Arzte, die dem primären Interesse der guten Patientenversorgung entgegenstehen können. Das Regelwerk der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) zur Erklärung von Interessen und Umgang mit Interessenkonflikten bei Leitlinienvorhaben dient der Validität und der Vertrauenswürdigkeit der Leitlinienempfehlungen.
Leitlinienevaluation: Konzepte zur Definition und Messung von Leitlinienumsetzung und -adhärenz
Max GeraedtsDie Leitlinienevaluation folgt den Konzepten zur Evaluation komplexer Interventionen, indem zum einen formativ die Leitlinienumsetzung geprüft wird, das heißt deren Verbreitung, Bekanntheit und Akzeptanz in der Praxis ermittelt wird. Zum anderen wird die Leitlinienadharenz analysiert, indem Qualitätsindikatoren formuliert werden, die summativ den Grad der Befolgung der Leitlinienempfehlungen quantifizieren. Als zentrales Evaluationsinstrument müssen für leitlinienbasierte Qualitätsindikatoren u.a. Referenzbereiche und die zur Risikoadjustierung notwendigen Faktoren eruiert sowie potenzielle Datenquellen und die Machbarkeit in der Versorgungspraxis getestet werden. Dabei kommen zur Quantifizierung der Leitlinienadhärenz Primardaten, zunehmend aber auch Sekundardaten zum Einsatz, die im Rahmen von prä-post-Designs bis hin zu Cluster-randomisierten Studien den Umsetzungsgrad und die Wirkung einer leitlinienkonformen Behandlung prüfen. Zu beachten ist, dass konfligierende Leitlinienempfehlungen bei multimorbiden Patientinnen und Patienten sowie deren Compliance den Umsetzungsgrad beeinflussen können. Eine aktuelle Analyse der S3-Leitlinien in Deutschland zeigt, dass bisher nur ein Viertel der Leitlinien die für die Evaluation notwendigen Qualitätsindikatoren aufweisen, wobei diese fast ausschließlich aus der Onkologie stammen. Als Grund dafür nennen Leitlinienautorinnen und -autoren vor allem mangelnde Ressourcen. Daher kann erhofft werden, dass die nun im Rahmen des Innovationsfonds mögliche Finanzierung der Leitlinienentwicklung auch die zur Evaluation essenzielle Entwicklung leitlinienbasierter Qualitätsindikatoren fordert.
Teil II Leitlinienumsetzung in der Versorgungswirklichkeit - Untersuchungen mit Routinedaten
L-Dopa-Pharmakotherapie bei der Behandlung des Restless Leg Syndroms
Dagmar Drogan, Katrin Schüssel, Klaus Berger und Claudia TrenkwalderEine kontinuierliche Behandlung des Restless Legs Syndroms (RLS) mit L-Dopa wird in der aktuellen AWMF-Leitlinie aufgrund des hohen Risikos einer Zunahme der Beschwerden (Augmentation) nicht mehr empfohlen. Anhand von AOK-Abrechnungsdaten wurden bei Patientinnen und Patienten mit RLS das Ausmaß, die Behandlungsdauer und -dosis sowie versorgungsrelevante Begleitfaktoren einer kontinuierlichen L-Dopa-Therapie untersucht. Im Studienzeitraum (2013–2021) wurden 143.322 kontinuierliche L-Dopa-Behandlungsepisoden identifiziert, die sich auf 86.191 der eingeschlossenen 335.463 RLS-Patientinnen und -Patienten verteilten. Die meisten L-Dopa-Verordnungen wurden von Ärztinnen und Ärzten der Allgemeinmedizin ausgestellt. Sowohl eine längere Behandlungsdauer als auch eine größere Anzahl verordnender Arztinnen und Arzte waren assoziiert mit einer höheren täglichen L-Dopa-Behandlungsdosis und häufigerer Co-Medikation mit Dopaminagonisten bzw. Opioiden. Diese Ergebnisse konnten Ausdruck einer Augmentation infolge der Langzeit-L-Dopa-Behandlung sein, die dazu führt, dass Kombinationstherapien notwendig werden oder dass der steigende L-Dopa-Bedarf aus mehreren Bezugsquellen gedeckt wird (‚Arzte-Hopping‘). Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass verstärkte Anstrengungen notwendig sind, um in Zukunft eine leitliniengerechte Pharmakotherapie des RLS zu erreichen.
Leitlinienbasierte Versorgung bei Herzinsuffizienz
Dana van Gassen, Kristin Borgstedt, Guido Büscher und Gerhard SchillingerDer Beitrag untersucht empirisch anhand von AOK-Daten die Umsetzung von evidenzbasierten Leitlinienempfehlungen in Deutschland am Beispiel Herzinsuffizienz. Hierfür werden QISA-Indikatoren verwendet, die sich mit Krankenkassen- Routinedaten abbilden lassen. Diese werden ergänzt um die Rate der Influenza-Impfungen bei Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Die Analyse zeigt eine gute bis moderate Umsetzung der Leitlinienempfehlung zu ACE-Hemmern bzw. AT1-Blockern und Betablockern. Es findet sich eine deutliche Steigerung bei der Behandlung mit oralen Gerinnungshemmern bei Personen ab 65 Jahren mit einer Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern. Die Rate der Personen mit Herzinsuffizienz, die eine jährliche Influenza-Impfung erhalten, ist unbefriedigend.
Leitlinienkonformität bei der Durchführung von Kontroll-Koronarangiographien
Elke Jeschke, Christian Günster und Martin MöckelKontroll-Koronarangiographien nach perkutaner Koronarintervention (PCI) werden in den klinischen Leitlinien seit einigen Jahren nicht mehr empfohlen, wenn keine therapeutische Konsequenz zu erwarten ist. In dem vorliegenden Artikel wird untersucht, wie sich für elektive PCI-Patienten die Häufigkeit von Koronarangiographien im Jahr nach der PCI im Zeitraum von 2009 bis 2018 entwickelt hat. Als Ergebnis zeigt sich eine deutliche Abnahme der Koronarangiographien nach PCI innerhalb von 91 bis 365 Tagen, darunter auch der Kontroll-Koronarangiographien. Ursache für diese Entwicklung ist neben der geänderten Leitlinienempfehlung auch die medizinische Entwicklung mit optimierter Stenttechnologie und Begleittherapien und dem damit verbundenen geringeren Risiko der Progression der Koronaren Herzkrankheit (KHK) und von Rezidivstenosen. Deutliche regionale Unterschiede in der Eingriffshäufigkeit weisen auf weiteres Potenzial für eine stringentere Indikationsstellung in einzelnen Regionen hin.
Geschlechtsspezifische reale Versorgungssituation von arteriosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen - Ergebnisse aus dem Innovationsprojekt GenderVasc
Eva FreisingerGenderVasc untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Versorgung kardiovaskularer Patienten an Hand von Routine-Daten des Gesundheitssystems (Statistisches Bundesamt DESTATIS, AOK). Im Fokus der Untersuchungen stehen neben der deskriptiven Analyse von bundesweiten Versorgungstrends die Reflexion gültiger Leitlinienempfehlungen und Re-Translation von geschlechtsspezifischen Forschungsergebnissen in die klinische Real-Versorgung. Übergeordnetes Ziel des Projekts GenderVasc ist die Optimierung und der rationale Ressourceneinsatz des medizinischen Versorgungsbedarfs, um zu einer Verbesserung der Qualität, insbesondere der Ergebnisqualität, beizutragen.
Basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) wurden epidemiologische Trendentwicklungen zur Herzinfarktversorgung in Deutschland untersucht, sowie Arbeiten zum geschlechtsabhängigen Einfluss kardiovaskularer Risikofaktoren auf die Prognose der Herzinfarkt-Patienten veröffentlicht. So entfallen zwei Drittel aller Herzinfarkte weiterhin auf Patienten männlichen Geschlechts, Frauen mit ST-Hebungsinfarkt sind im Geschlechtsvergleich 12 Jahre alter und weisen häufiger kardiovaskulare Komorbiditäten auf. Im Rahmen der stationären Behandlung kamen invasive Therapieverfahren bei weiblichen Behandlungsfallen signifikant seltener zum Einsatz, insbesondere bei Patientinnen im Alter < 40 Jahren und > 80 Jahren. Die beobachtete Krankenhaussterblichkeit war bei STEMI-Patientinnen auf Bundesebene mit 15% gegenüber männlichen STEMI-Patienten (10%, p < 0.001) relevant erhöht. Analog belegen deskriptive Analysen zur Real-Versorgung von Patientinnen und Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit eine dramatische Unterversorgung insbesondere in kritischen Krankheitsstadien entgegen allen gültigen Leitlinienempfehlungen.
Die Ergebnisse der bisherigen Studien fanden direkten Eingang in tägliche klinische Behandlungsentscheidungen. Gestützt wurde dies durch eine Implementierung in Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften, wie für die von den GenderVasc-Kollaboratoren publizierten Erkenntnisse zur epidemiologischen Entwicklung von koronarer und peripherer Arteriosklerose sowie der dramatischen Unterversorgung mit revaskularisierenden Maßnahmen in die S3-Leitlinie für pAVK ersichtlich ist.
Kreuzschmerz: Konvergenz und Divergenz der Versorgung mit der Einführung der NVL Kreuzschmerz
Falko Tesch, Toni Lange, Dieter C. Wirtz und Jochen SchmittDie Einführung der Nationalen VersorgungsLeitlinie (NVL) Kreuzschmerz im Jahr 2010 führte für Deutschland erstmals Empfehlungen für das Feld der diagnostischen und therapeutischen Verfahren für die Versorgung von Menschen mit unspezifischen Kreuzschmerzen zusammen. In den Folgejahren bis 2016 veränderte sich die Häufigkeit der Anwendung dieser Verfahren. Unterschiede in der Versorgung zwischen den Regionen Deutschlands nahmen teilweise ab (Konvergenz), etwa für die Magnetresonanztomografie, die Verschreibung von Nichtopioid-Analgetika oder die Anwendung der multimodalen Schmerztherapie. Umgekehrt kam es zu einer Zunahme der regionalen Unterschiede in der Versorgung (Divergenz) für Röntgenaufnahmen, Akupunktur, der Verordnung von Massagen und starkwirksamen Opioiden. Dem Ziel der NVL Kreuzschmerz, die Qualität der Versorgung zu harmonisieren, stand bei einigen Verfahren ein ausgeprägtes regionales Muster der Versorgung entgegen, das auch in den Folgejahren bestehen blieb.
Tonsillektomie: Leitlinienadhärenz bei der Indikationsstellung
Caroline Schmuker, Christian Günster und Jochen P. WindfuhrFür Deutschland liegt seit 2015 erstmals eine medizinische Leitlinie (LL) zur Therapie entzündlicher Erkrankungen der Gaumenmandeln vor. Die LL empfiehlt die chirurgische Entfernung der Gaumenmandeln (Tonsillektomie, TE) erst dann, wenn sich in den letzten 12 Monaten mindestens 6 ärztlich diagnostizierte und antibiotisch behandelte Tonsillitisepisoden ereignet haben. Diese Studie geht der Frage nach, wie hoch der Anteil der TE-Patienten und Patientinnen ist, die präoperativ in höchstens einem Quartal wegen Halsschmerzen in ambulanter Behandlung waren und ein Antibiotikum erhielten. Diese Operationalisierung war notwendig, da die Anzahl der Halsschmerzepisoden innerhalb eines Quartals mit der verfügbaren Datengrundlage nicht bestimmt werden kann.
Datengrundlage sind AOK-Routinedaten aus dem Zeitraum 2012 bis 2019 von Versicherten mit Tonsillektomie wegen „chronischer Tonsillitis“. Für die Analyse der präoperativen Behandlung wurde ein patientenindividueller Beobachtungszeitraum von 5 Quartalen betrachtet.
Der Anteil der Patienten und Patientinnen, die vor Tonsillektomie in höchstens einem Quartal ambulant wegen Halsschmerzen behandelt wurde, ist von 50,1 Prozent im Jahr 2012 (10.099/20.173) auf 44,2 Prozent im Jahr 2019 (3.737/8.449) kontinuierlich zurückgegangen. In der regionalen Betrachtung zeigten sich Unterschiede. Die Anteile der tonsillektomierten Personen ohne ambulante Vorbehandlung variierten regional zwischen 34,7 und 59,8 Prozent. Auch unter Berücksichtigung methodischer Limitationen wurden mehr Patienten und Patientinnen mit einer geringen bis fehlenden Belastung durch Halsschmerzepisoden tonsillektomiert, als es die Leitlinienempfehlung erwarten ließ.
Teil III Handlungsfelder: Wie bringen wir medizinische Leitlinien in die Versorgung?
Implementierung klinischer Leitlinien: ein systematischer Ansatz
Michel WensingDieser Beitrag beschreibt einen systematischen Ansatz für die Implementierung klinischer Leitlinien in fünf Schritten: 1) Definition der Implementierungsziele, 2) diagnostische Analyse für die Umsetzung, 3) Wahl und Ausgestaltung der Umsetzungsstrategien, 4) Planung und Durchführung der Umsetzung, 5) Evaluation von Prozess und Ergebnissen.
Entscheidungshilfen als Beispiel für Leitlinienimplementierung
Fülöp Scheibler, Marion Danner, Jens Ullrich Rüffer und Friedemann GeigerEntscheidungshilfen für Patientinnen und Patienten und Leitlinien für klinisches Personal haben einige Gemeinsamkeiten. Beispielsweise wird gefordert, dass sie evidenzbasiert sein sollten, also auf Grundlage der aktuellen und systematisch erfassten Ergebnisse der hochwertigsten verfügbaren klinischen Studien zu den jeweiligen (Schlüssel‑) Fragestellungen erstellt werden sollten. Beide haben das Ziel, Entscheidungen bezüglich der Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Gesundheitsversorgung auf Basis eines informierten und rationalen bzw. empirischen Fundaments zu fallen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie in der Praxis weniger oft eingesetzt werden, als dies wünschenswert wäre. Dieser Beitrag befasst sich mit der Fragestellung, wie dieses Ziel in einem größeren Rahmen erreicht werden kann und wie sich diejenigen, die Leitlinien und Entscheidungshilfen entwickeln, gegenseitig dabei unterstutzen konnten. Am Beispiel eines Projekts, das vom Innovationsfonds gefordert wurde im Rahmen dessen über vier Jahre Shared Decision Making am gesamten Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein implementiert wurde, sollen Möglichkeiten und Grenzen dieser gegenseitigen Beflügelung aufgezeigt und Synergien ausgelotet werden.
Leitlinien zur Förderung der Patientenbeteiligung und -information
Corinna Schaefer und Jutta HübnerLeitlinien können die Beteiligung und Information von Patientinnen und Patienten mit folgenden Strategien fordern: Die erste ist, ärztliche Leitlinien so planen und gestalten, dass sie für die Betroffenen relevante Fragen und Bedürfnisse spiegeln. Dies betrifft für den Geltungsbereich und die Schlusselfragen, die Priorisierung von Endpunkten oder die Darstellung der Optionen im Text. Förderlich für diese Strategie ist es, a) Betroffene am gesamten Prozess der Leitlinienerstellung zu beteiligen und b) durch formale Vorgaben bei der Aufbereitung der Leitlinie das Arzt-Patienten-Gespräch zu unterstutzen, beispielsweise die Wortwahl, das Festlegen bestimmter obligatorischer Kapitel oder eine vergleichende Darstellung möglicher Optionen. Dadurch werden Behandelnde besser in die Lage versetzt, zu informieren und partizipative Entscheidungsfindung zu initiieren. Die zweite Strategie besteht darin, die relevanten Inhalte einer Leitlinie direkt für die Betroffenen aufzubereiten. Leitlinienbasierte Entscheidungshilfen ermöglichen es, informierte Gesundheitsentscheidungen – im Idealfall gemeinsam mit den Behandelnden – zu treffen. Andere Formate wie Patientenleitlinien können das individuelle Wissen um die Erkrankung verbessern. Insbesondere, wenn Informationen auf multidisziplinaren Leitlinien mit einem strukturierten Konsensprozess beruhen, bieten sie einen Mehrwert gegenüber anderen evidenzbasierten Gesundheitsinformationen: In solche Leitlinien gehen die kollektive klinische Erfahrung der Beteiligten sowie deren teils sehr unterschiedliche Perspektiven in die Evidenzbewertung ein. Trotz der Möglichkeiten, die Leitlinien zur Stärkung der Patientensouveränität bieten, wirken sich andere, auch mit Leitlinien verbundene Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems wie Qualitätsindikatoren, Zertifizierung oder Benchmarking, eher kontraproduktiv auf die Einbeziehung der Betroffenen aus.
Professionsentwicklung: Wie kommen Leitlinien stärker in die medizinische Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung?
Jana JüngerDie Prinzipien der evidenzbasierten Medizin (EBM) und der Leitlinieninitiative der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) sowie vieler Fachgesellschaften bilden die Grundlagen für eine patientenzentrierte Medizin, die Uber- und Unterversorgung verhindert. Derzeit weist die Anwendung von Leitlinien in der ärztlichen Praxis ein Verbesserungspotenzial auf. Studierende haben bisher wenig Berührungspunkte mit Leitlinien in Lehre und Prüfung, da diese für die ärztliche Weiterbildung und den fachärztlichen Versorgungsbereich ausgelegt sind.
Die Verankerung von Wissenschaftskompetenzen im Studium und deren Überprüfung in den fakultären und staatlichen Prüfungen sind zentrale Voraussetzungen, um eine flachendeckende Implementierung der Anwendung von Leitlinien und evidenzbasierter Medizin in der Praxis zu erreichen. Dazu sind die entsprechenden Lernziel- und Prüfzielkataloge umzugestalten, adäquate Lehrformate zu entwickeln, innovative Prüfungen zu etablieren und die Zusammenarbeit zwischen Fachgesellschaften, AWMF und Dozierenden sowie Prüfenden zu intensivieren. Der Masterplan Medizinstudium 2020, der statt auf die Lehre von Fakten und Wissen starker auf die Vermittlung von Kompetenzen und Fertigkeiten zielt, bietet die Grundlage, um evidenzbasierte Medizin und Leitlinienorientierung in das Medizinstudium aufzunehmen.
In den aktuell gültigen IMPP-Gegenstandskatalog (GK2) wurden erstmalig im Jahr 2019 explizit Lernziele zu Leitlinien aufgenommen. Die Kennzeichnung von studierendengerechten Leitlinieninhalten bei der Aktualisierung der Gallensteinleitlinie (Lynen Jansen et al. 2018) zeigt konkrete Umsetzungsmöglichkeiten auf und kann als Orientierung dienen, wie für Studierende relevante Inhalte in Leitlinien künftig gekennzeichnet werden können. In der Lehre haben sich von ersten Pilotierungen der Vermittlung von Leitlinien in der Allgemeinmedizinischen Lehre bis hin zu internationalen Curricula zu Clinical Reasoning in den letzten 15 Jahren enorme Entwicklungen aufgetan. Neue Prüfungsformate für schriftliche und praktische Prüfungen, wie in dem aktuellen Referentenentwurf für die Ärztliche Approbationsordnung (AApprO) vorgesehen, wurden mehrfach im ambulanten und stationären Bereich erprobt. Sie zeigen, dass die Implementierung der reflektierten Anwendung von Leitlinien in Lehre und fakultären Prüfungen wie auch in den abschließenden Staatsprüfungen möglich ist. In medizindidaktischen Qualifizierungsprogrammen für Aus‑, Weiter- und Fortbildung wie z.B. dem MedizinDidaktikNetz Deutschland (www.medidaktik.de/) des Medizinischen Fakultätentags und dem Master of Medical Education (Junger et al. 2020) sollten Multiplikatoren aller Fachrichtungen starker qualifiziert werden, um die Implementierung von Leitlinienkompetenz in Lehre und Prufung zu fordern.
Integration von Leitlinien in die Qualitätsförderung mit QISA und QuATRo
Guido Büscher, Johannes Stock, Andreas Lipécz, Kristin Borgstedt, Edith Andres, Jörg Lindenthal und Katrin KrämerLeitlinien entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie nachhaltig im Alltag der Gesundheitsversorgung ankommen. Exemplarisch werden zwei Ansätze tiefergehend dargestellt, welche die Leitlinienadhärenz in der ambulanten ärztlichen Versorgung fordern: Das Qualitätsindikatorensystem für die ambulante Versorgung (QISA) und dessen Einsatz im Qualitätsmessverfahren QuATRo („Qualitat in Arztnetzen – Transparenz mit Routinedaten“). Dabei wird auch auf den gemeinsamen Entwicklungsaspekt wie z.B. die gegenseitige Ruckkopplung von Ergebnissen und Erfahrungen eingegangen. Nach einer näheren Beschreibung von QISA und QuATRo wird deren Umsetzung am Beispiel der vernetzten und kooperativen Herangehensweise eines Arztnetzes erläutert und aufgezeigt, welche Impulse für die netzinterne Qualitätsarbeit ausgelost werden. Untersuchungen zeigen, dass diese Herangehensweise nicht nur die Leitlinienadhärenz, sondern auch die Qualität der Versorgung messbar verbessert.
Zertifizierung mit Leitlinienkomponente: das Zertifizierungssystem der Deutschen Krebsgesellschaft
Johannes Rückher, Markus Follmann, Martin Utzig und Simone WesselmannHintergrund: In den letzten Jahren hat eine zunehmende Zahl an Arbeiten die Vorteile der Behandlung in zertifizierten Zentren in Bezug auf verschiedene Tumorentitäten gezeigt. Der vorliegende Beitrag stellt die Frage, inwieweit Leitlinieninhalte Anteil an diesen Vorteilen haben. Dazu werden die verschiedenen Schnittstellen von Zertifizierungssystem mit onkologischen S3-Leitlinien dargestellt.
Zentrale Erkenntnisse: Der Qualitätszyklus Onkologie beschreibt, wie Empfehlungen der Leitlinien Eingang in die Zertifizierungssysteme erhalten, wie deren Umsetzung beurteilt und gemessen wird – und nicht zuletzt, welche Konsequenzen die Leitliniengruppen aus diesen Ergebnissen ziehen. Darüber hinaus hat das Zertifizierungssystem weitere Möglichkeiten, die Auseinandersetzung mit Leitlinienwissen zu fordern, etwa durch Übernahme zentraler Empfehlungen in die Zertifizierungskataloge, Verweise auf die Leitlinien in den Zertifizierungsdokumenten oder durch die Erarbeitung von Checklisten/Handreichungen für den klinischen Alltag.
Fazit: Leitlinienempfehlungen sind eine wesentliche Grundlage der Anforderungen an zertifizierte Krebszentren und bilden deren fachliches Fundament. Ihre Umsetzung in der Versorgung wird im Zertifizierungssystem durch regelmäßige Audits und die Messung von Qualitätsindikatoren geprüft. Leitlinien haben somit einen wesentlichen Einfluss auf die Effekte der Zertifizierung.
Leitlinien und Disease-Management-Programme: Bedeutung und Wechselwirkung
Corinna Schaefer und Martin HärterDer Gesetzgeber hat festgelegt, dass Disease-Management-Programme (DMP) unter Berücksichtigung evidenzbasierter Leitlinien oder gemäß der jeweils bestverfügbaren Evidenz erstellt werden sollen. Da DMP speziell für den deutschen Versorgungskontext entwickelt werden, erscheint es sinnvoll, dass insbesondere deutsche Leitlinien Eingang in DMP finden. Im Rahmen der systematisch ermittelten Leitliniensynopsen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) gehören deutsche S3-Leitlinien und Nationale Versorgungs-Leitlinien in der Regel zu den am besten bewerteten. Dokumentation und Qualitätszielerhebung der DMP stellen eine wichtige Datenquelle für die Aktualisierung von Leitlinien dar, weil die Erhebung Starken und Schwachen der Versorgung dokumentiert, auf die Leitlinien reagieren können. DMP können zur Implementierung von Leitlinienempfehlungen und damit auch zur Verbesserung klinischer Endpunkte beitragen. Allerdings sind die neueren DMP bislang nicht in konkrete Verträge umgesetzt worden, sodass es für Herzinsuffizienz, Depression, chronische Rückenschmerzen, Osteoporose und rheumatoide Arthritis keine entsprechenden Versorgungsangebote gibt.
Leitlinienkomponenten in der Vertragsgestaltung einer gesetzlichen Krankenkasse
Sabine Hawighorst-Knapstein, Kateryna Karimova, Catriona Friedmacher und Dorothea LemkeDer interdisziplinar fachübergreifenden Versorgungsqualität liegt das Prinzip der evidenzbasierten Medizin mit dem Ziel bestmöglicher Patientenversorgung zugrunde. Die inhaltlichen Grundsätze der Leistungserbringung zur Versorgung der Versicherten sind sozialrechtlich vertraglich auf Nachweise (Evidenz) der Wirksamkeit und des Nutzens zu stutzen. Die fachlichen Maßstäbe beruhen dafür, zum Beispiel bei Vollversorgung, auf Vorgaben gemäß § 70, § 2, § 12, § 73b SGB V „mindestens auf G-BA-Niveau“ und vormals analog § 73c SGB V/neu § 140a: 1. der evidenzbasierten Medizin nach aktuell anerkanntem Sachstand der medizinischen Erkenntnisse bzw. gemäß Facharztstandard und -literatur, 2. den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, 3. den Empfehlungen des Sachverständigenrats und Ergebnissen der Gesundheitsberichterstattung (Robert Koch-Institut, GBE-Bund), um diagnosebezogene Versorgungsdefizite insbesondere bei chronischen Erkrankungen und entsprechende Risikofaktoren zu berücksichtigen und 4. hochwertigen Leitlinien, z.B. zur Aufklarung, zur Prävention durch Beratung und als biopsychosoziale Koordination (zu unterscheiden in der fachlichen Qualität sind die haus- von den spezial-fachärztlichen Leitlinien). § 12 SGB V verdeutlicht explizit, dass das Wirtschaftlichkeitsgebot keine Abstriche bei der Wirksamkeit der diagnosebezogenen Leistungen bedeutet. Durch diese sozialrechtlichen Grundsätze zur Leistungserbringung und -erstattung ist die systematische wissenschaftliche Überprüfung der Wirksamkeit von Leistungen als fachlicher Maßstab der Gesundheitsversorgung verankert.
Der Beitrag erläutert die Voraussetzungen und das Versorgungskonzept der Haus- und Facharztvertrage der AOK Baden-Württemberg nach vorgenannten Grundsätzen und berichtet Ergebnisse der unabhängigen Evaluation der Versorgungsvertrage.
Netzwerke zur Förderung von Leitlinienumsetzung und des klinischen Nutzens für die Patienten am Beispiel des nationalen Netzwerks Genomische Medizin (nNGM) Lungenkrebs
Anna Kron, Reinhard Büttner und Jürgen WolfAufgrund der zunehmenden Personalisierung und der daraus resultierenden Komplexität in der Behandlung onkologischer Patienten, die sich nicht zuletzt durch immer kleiner werdende molekular-definierte Patienten- Subgruppen auszeichnet, ist die Versorgung in klinischen Netzwerken zukunftsweisend für eine sinnvolle und gleichzeitig wissensgenerierende Arbeitsteilung aller Akteure. Dabei können Leistungserbringer aus Kliniken und Praxen ihr fachübergreifendes Expertenwissen direkt miteinander teilen und so zu einem schnelleren multidirektionalen Innovationstransfer beitragen. Sowohl die Umsetzung bestehender Leitlinien als auch ihre Evaluierung zum Zweck einer fortlaufenden Verbesserung der Versorgungsrealität in der Fläche werden durch die klinischen Versorgungsnetzwerke gefordert. Am Beispiel von Lungenkrebs, der häufigsten Ursache für krebsbedingte Todesfalle (Destatis 2021), wird mit dem nationalen Netzwerk Genomische Medizin (nNGM) gezeigt, wie umfassende Strukturen für eine Leitlinien-konforme und zugleich forschungsnahe Behandlung der betroffenen Patienten erfolgreich aufgebaut und in der Breite der Versorgung umgesetzt werden können.
Digitalisierung der Leitlinienarbeit und Entscheidungsunterstützungssysteme
Martin Sedlmayr und Brita Sedlmayr„Die digitale Transformation verspricht disruptive Entwicklungen zur Verbesserung des medizinischen Wissensmanagements und der medizinischen Versorgung“.
(AWMF 2023a)
Leitlinien enthalten wissenschaftlich begründetes und praxisorientiertes Wissen zu angemessenen ärztlichen Vorgehensweisen bei speziellen gesundheitlichen Problemen. Digitale Technologien können sowohl bei der Erstellung und Verbreitung dieses Wissens helfen als auch bei der Operationalisierung am Point-of-Care. Aufgrund der zunehmenden diagnostischen und therapeutischen Optionen und der entsprechenden Leitlinienspezifikationen ist es für medizinisches Personal zur Herausforderung geworden, den Leitlinienempfehlungen angemessen zu folgen und gleichzeitig die immer komplexeren Patientenmerkmale zu berücksichtigen. Klinische Entscheidungsunterstutzungssysteme können hier das medizinische Personal bei der Entscheidungsfindung aktiv unterstutzen und die klinische Behandlung von Patienten und Patientinnen durch die Bereitstellung evidenzbasierter Empfehlungen leiten. Dieses Kapitel zeigt Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Herausforderungen der (Weiter‑)Entwicklung, Verbreitung und Anwendung von Leitlinien auf, die sich durch den Einsatz digitaler Technologien ergeben. Zunächst werden die Grundlagen digitaler Leitlinienmodelle und Entscheidungsunterstutzungssysteme vorgestellt. Anschließend werden entlang des Lebenszyklus von Leitlinien einzelne Beispiele für digitale Werkzeuge präsentiert. Abschließend werden Herausforderungen für den Einsatz digitaler Werkzeuge benannt.
Teil IV Daten und Analysen
Diagnosehäufigkeit und Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
Caroline Schmuker, Carolin Polte, Ghassan Beydoun und Christian GünsterDer Beitrag berichtet für das Jahr 2021 die Häufigkeit von Erkrankungen und Behandlungen in Deutschland. Um Auswirkungen der Coronaviruspandemie zu berücksichtigen, werden für zentrale Kennzahlen die Vergleichswerte des Jahres 2019 vor der Pandemie ausgewiesen. Die Analysen basieren auf standardisierten Abrechnungsdaten von AOK-Versicherten, die auf die deutsche Wohnbevölkerung hochgerechnet wurden. Dargestellt werden administrative Behandlungsprävalenzen sowie Kennziffern zur Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen in den vier ausgabenwirksamsten Leistungssektoren: der stationären Krankenhausversorgung, der ambulant-ärztlichen Versorgung, sowie der Arzneimittel- und Heilmittelversorgung.